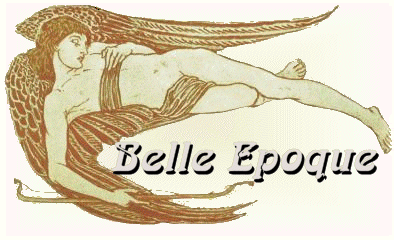Die Belle Epoque in Europa
Deutschland
München (Bayern)
1892: Die erste Secession

Im ausgehenden 19. Jahrhundert war München ein Anziehungspunkt für deutsche Künstler jeder Herkunft und Richtung, die sich berufen fühlten, etwas Neues zu schaffen. München war eine junge, moderne, aufregende Stadt, die es den Künstlern ermöglichte, neue Stilrichtungen zu schaffen. Man beschäftigte sich intensiv mit den neuen Künsten, wobei die Münchner Ausprägungen der neuen Stile oft spielerischer Natur waren und durchaus auf den althergebrachten Richtungen wie beispielsweise des Historizismus oder des Barock basierten. Nicht zuletzt verdankt die deutsche Spielart der Art Nouveau ihren Namen einer in dieser Stadt erschienen neuen Kulturzeitschrift, der Jugend.

Darüber hinaus erwarb sich München historischeVerdienste hinsichtlich der übrigen Secessionsbewegungen
in Europa durch die Gründung der Münchner Secession im Jahr 1892 und durch
die Schaffung der zukunftsweisenden Vereinigten Werkstätten für Kunst im
Handwerk 1898. Die Stadt war zum Sammelpunkt von Künstlern jeglicher Art und Genialität
geworden, welche eine internationale Boheme bildeten, deren geistiger und kultureller Mittelpunkt, vor
allem der Literaten, sich in Schwabing befand, dem einstigen Dorf am Rande der Stadt. Um die zentrale
Figur des "Künstlerfürsten" Franz von Stuck (1863-1928) gruppierten sich unter vielen anderen
August Endell (1871-1925), Hermann Obrist (1862-1927),
Richard Riemerschmid (1868-1957), Bruno Paul (1874-1968), Leo Putz (1869-1940), Thomas Theodor Heine
(1867-1948) sowie der große Jugendstilkünstler und Architekt
Peter Behrens (1868-1940). Der literarische Zirkel bestand vor allem aus Stefan George (1868-1933),
Ludwig Thoma (1867-1921), Frank Wedekind (1864-1918), Karl Wolfskehl (1869-1948), Otto Julius Bierbaum
(1865-1910), Thomas Mann (1875-1955) und Rainer Maria Rilke (1875-1926).
Das um 1900 in München geschaffene Kunstgewebe, die Keramik, das Porzellan, war auf eine positive
Art volkstümlich, recht unmittelbar und von schöner einfacher Erfindung. Man bewegte sich
allgemein mehr im Bereich der dekorativen und angewandten als in dem der hohen Künste. Neben dem
Kunstgewerbe war es das grafische Schaffen, das den Münchener Jugendstil über die Grenzen
der Stadt hinaus trug.
Münchener Secession
Im April 1892 schlossen sich mehr als hundert Künstler zum "Verein bildender
Künstler Münchens e. V. Secession" zusammen. Es handelte sich um eine echte Sezession, da
rund drei Viertel von ihnen noch Mitglieder der Königlich-privilegierten Münchener
Künstlergenossenschaft (MKG) waren, die unter dem "tyrannischen" Einfluss des "Malerfürsten"
Franz von Lenbach (1836-1904) standen. Unter vielen anderen prominenten Künstlern befanden sich
auch Franz von Stuck, Peter Behrens, Max Liebermann (1847-1935) und Lovis Corinth (1858-1925), die den
Historizismus, den die Akademien lehrten und predigten, ablehnten und Neues erschaffen wollten. Eine
ihrer Maximen, die den Jugendstil weltweit auszeichnete, war, dass Kunst den ganzen Menschen und das
gesamte gesellschaftliche Leben beträfe.
Obwohl sich Lenbach, seine führende Stellung und seinen Einfluss beim Prinzregenten Luitpold und
Kultusminister Müller ausnutzend, alle Mühe gegeben hatte, gegen die Avantgarde zu
intrigieren, konnte im Sommer 1893 die erste internationale Ausstellung der Secession stattfinden.
Entgegen den Bemühungen Lenbachs stand der Einsatz des Kunstsammlers und Verlegers der
Jugend, Georg Hirth, des Sozialistenführers Georg von Vollmar
sowie des Grafen von Toerring-Jettenbach, die sich für die Secessionisten engagierten und es
erreichten, dass den jungen Künstlern für ihre Suche nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten
offizielle Anerkennung zuteil wurde.
Im gleichen Jahr verließ eine weitere Gruppe von Künstlern die MKG und gründete die
"Luitpold-Gruppe". Im Jahre 1899 wurde von einer Gruppe von Malern, welche alle Mitarbeiter der
Jugend waren, eine weitere separatistische Künstlervereinigung
unter dem Namen "Gruppe G" gebildet.
Wesentlich bedeutsamer für den Münchener Jugendstil als die Secession, weil in entscheidender
Weise prägend, war die Gründung der Vereinigten
Werkstätten für Kunst im Handwerk im Jahre 1898. Jedoch war die Secession mit allen neu
gebildeten Künstlervereinigungen im Wesentlichen solidarisch und es sollten noch einige Jahre
vergehen, bis Berlin und Wien dem Münchener Beispiel folgten.
Die Jugend

Die Zeitschrift wurde im Januar 1896 von dem Münchener Verleger Georg Hirth gegründet. Sie
bezeichnete sich selbst als "Wochenzeitschrift für Kunst und Leben" und beobachtete die
Modeströmungen und Entwicklungen in der Kunst der Jahrhundertwende vor allem in Deutschland,
informierte aber auch über die grafischen Neuerungen des Auslandes. Fast jeder Münchener
Jugendstilkünstler von Rang hat sporadisch oder regelmäßig Beiträge für die
Jugend geliefert.
Obwohl sie mit der Entstehung und der Entwicklung des Jugendstils recht wenig zu tun hatte, bleibt sie
doch durch die Tatsache, dass die deutsche Art Nouveau, der Jugendstil, nach ihr benannt wurde,
untrennbar mit ihm verbunden. Berühmt geworden sind ihre Vignetten von Otto Eckmann (1865-1902)
und die farbigen Blätter von Hans Christiansen (1866-1945), welche dem in der ersten Nummer der
Jugend veröffentlichten Motto folgten: "Alles, was an Althergebrachtes anlehnt, wird
ausgeschlossen." Die Neuheit und Kühnheit ihrer Illustration und ihres ornamentalen Schmuckes
hatten sicherlich einen ganz wesentlichen Einfluss auf die Druckgrafik und Buchkunst im Deutschland
der Jahrhundertwende.
Es muss jedoch gesagt werden, dass neben der beeindruckenden künstlerischen Ausstattung die
Inhalte der Jugend weniger sorgfältig ausgesucht waren und relativ wahllos alles
veröffentlicht wurde, von dem man annehmen konnte, dass es den neuen Geschmack traf, so dass
neben frischer, frecher echter Kunst auch Biederes und Sentimentales bis hin zum Kitsch zu finden
war.
Vereinigte Werkstätten für Kunst im Handwerk
Der Jugendstil hat seine Entstehung ursprünglich und in erster Linie dem
kunstgewerblichen Handwerk zu verdanken, und so ist seine Entwicklung auch in München in erster
Linie mit der Gründung der Vereinigten Werkstätten verbunden; diese fand im Jahre 1898 aus
Anlass der "Ausstellung für Kunst und Handwerk" statt, welche offen legte, dass schon seit
Längerem eine Reihe junger Künstler, zumeist Maler und Bildhauer, erfolgreich an der
Neubelebung des Kunstgewerbes gearbeitet hatten. Der intellektuelle und künstlerische Kopf
der Bewegung war Hermann Obrist.
Die jungen Künstler standen im Wesentlichen vor zwei Problemen: Sie mussten die technischen
Bedingungen des Handwerks erlernen und, nachdem sie ihr künstlerisches Schaffen vollendet hatten,
dieses vermarkten. Für diese beiden Ziele wurden die Vereinigten Werkstätten gegründet.
Sie kauften jungen Künstlern ihre Entwürfe ab oder verschafften ihnen Aufträge zu
größeren Innenausstattungen, welche dann von leistungsfähigen Handwerkern oder
Industrieunternehmen ausgeführt wurden; außerdem wurden die fertigen Kunstwerke in
permanenten oder temporären Ausstellungen der Öffentlichkeit präsentiert und zum Kauf
angeboten, wobei den Künstlern häufig noch ein Anteil am Erlös zugestanden wurde. Auf
diese Weise konnten sich die Künstler unabhängig von den wirtschaftlichen Problemen ihres
Schaffens ganz der Entwicklung einer modernen Kunst des täglichen Lebens widmen. So konnten sich
die Vereinigten Werkstätten auf der Weltausstellung 1900 in Paris mit Innenausstattungen
präsentieren, die einen durchschlagenden Erfolg hatten.
Später gründeten die Werkstätten, um preiswerter produzieren zu können, einen
eigenen Fabrikbetrieb insbesondere für Kunstschreinerei und kleinere Ateliers für
Metallarbeit, Stickerei und Weberei.
So waren die Werkstätten viele Jahre lang der Mittelpunkt der begabtesten Münchener
Künstler auf dem Gebiet der neuen Gebrauchskunst. Neben den eigentlichen Gründern Hermann
Obrist und F. A. O. Krüger (geb. 1875) waren es besonders Richard Riemerschmid, Bernhard Pankok
(1872-1943), Bruno Paul und Paul Haunstein (1880-1944), die die Arbeiten der Vereinigten
Werkstätten prägten.