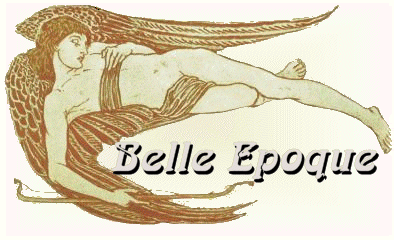Die Belle Epoque in Europa
Deutschland
Greiz (Thüringen)
Jugendstilarchitektur in Greiz - Auf der Europäischen Straße des Jugendstils
Wer sich mit dem Erbe des Jugendstils bekannt machen möchte, wird hiermit zu einem besonderen Spaziergang auf dem Greizer Teilstück
der Europäischen Straße des Jugendstils eingeladen. Neben Metropolen wie Barcelona, Wien, Brüssel oder Paris und Riga gehört auch Greiz
zur internationalen Interessengemeinschaft von Städten mit Jugendstil. Die Gebäude des Jugendstils haben auch nach über einhundert Jahren
ihre ganz spezifische Ausstrahlung bewahrt und faszinieren noch immer. Innerhalb weniger Jahre fand der Jugendstil in ganz Europa weite
Verbreitung und wurde eines der Sinnbilder für die Belle Epoque (frz. für "schöne Epoche"') im Vorfeld des Ersten Weltkrieges. Dass es in
Greiz eine beträchtliche Anzahl an attraktiven Jugendstilbauten zu entdecken gibt und die Stadt an der Weißen Elster damit eine kleine
Schwester namhafter europäischer Jugendstilstädte ist, mag auf den ersten Blick etwas erstaunen. In der ehemaligen Hauptstadt des Fürstentums
Reuß älterer Linie - die im 19. Jahrhundert einen großen Aufschwung ihrer Textilindustrie erlebte - gab es eine Reihe aufgeschlossener,
potenter Bauherren und Architekten, die sich des zeitgenössischen Stils annahmen. Beachtenswert in Greiz ist die Zweckvielfalt, die den
Jugendstilgebäuden zugrunde liegt. Nachfolgend finden Sie ausgewählte Beispiele von Wohnungs-, Kirchen-, Schul-, Industrie- und Kaufhausbauten
bis hin zum Brückenbau.
Die in der Innenstadt liegenden Jugendstil-Perlen wurden von der Tourist-Information Greiz in einem individuellen Jugendstil-Rundgang festgehalten.
Sie können sich diesen Flyer als PDF downloaden oder einem virtuellen
Rundgang folgen.
Texte von Katja Lux und Jacqueline Bräunlich, deren Buch Jugendstil in Greiz
im Juni 2024 erscheinen wird und schon jetzt vorbestellt werden kann.
Fotos von Matthias Lachmann, Joel Wrench, Jacqueline Bräunlich und Katja Lux außer Gottesackerkirche © Lutz Zürnstein
Burgstraße 5
Das 1904 erbaute Wohn- und Geschäftshaus in der Burgstraße zählt zu den ausgereiftesten Schöpfungen der Jugendstil-Architektur in Thüringen. Das Bauwerk, dessen Handschrift vermutlich die eines auswärtigen Baumeisters trägt, offenbart das Jahr 1904 in einer Inschrift im Treppenhausrisalit. Es besticht durch seine ausdrucksstarke Bauplastik und seine vielgestaltige Pflanzenornamentik. Bäumen, Blättern, Blumen und Blüten kamen im Jugendstil eine besondere Bedeutung zu. Pflanzen eroberten in freier schöpferischer Variation auch die Fassaden der Gebäude. Rosen waren prädestiniert für eine Gestaltung im Sinne des Zeitgeschmacks, vermitteln sie doch den Eindruck von Bewegung und gutem Gedeihen. Insbesondere das mit Pilastern gefasste Treppenhaus an der Burgstraße wurde bis zum Giebel reich mit stilisierten Rosen verziert.
Marktstr. 4/Thomasstr. 9
Nach der Brandkatastrophe 1902 übernahmen die Gebrüder Randel die Brandstelle von dem Kaufmann
Max Foerster. Sie führten in Greiz ein Baugeschäft und schufen vermutlich das aufwendig gestaltete Wohn- und Geschäftshaus.
Die Fassade präsentiert sich mit einem asymmetrischen Gesamteindruck, weist aber immer wieder Symmetrien in der Einzelform auf.
An der Marktstraße betont ein mehrgeschossiger Erker die Gebäudemitte und ist dem großen geschweiften Zwerchgiebel
unsymmetrisch vorgelagert. Der Hauptgiebel ist erfüllt mit floralen Jugendstilornamenten. Von dort oben strahlt eine Sonne und
vermittelt Zuversicht auf eine strahlende Zukunft.
Gestalterisch bildet der ausdrucksstarke Erker den Schwerpunkt dieser Schauseite. Von schwungvollen Blattmotiven und wellenförmigen
Linien umrankte Frauengesichter prägen die Brüstungsfelder.
Historische Fotos belegen, dass an der Fassade zur Thomasstraße viel mehr Stuckornamente vorhanden waren. Erhalten geblieben ist der
mit Pflanzen und Blüten verzierte Erker. Unterhalb des Sohlbankgesims vermischen sich florale mit faunistischen Motiven.
Thomasstr. 15/17 - Marktstr. 14/12
Unter den Jugendstil-Bauten in der Markt- und Thomasstraße ist dieses Doppelhaus eines der interessantesten
und ansehnlichsten. Kontraste durch Farbe, Oberflächenstruktur, Materialität und Plastizität verleihen der Fassade eine eigene
Charakteristik.
An der Fassade zur Marktstraße finden wir im Mittelrisalit unterhalb des Zwerchgiebels eine Kartusche mit einer Eule, auf der das Baujahr
1903 festgehalten ist. Die Eule ist ein gern verwendetes Jugendstilmotiv, Symbol von Weisheit und Schutz.
Arno Daßler, ein einheimischer Baumeister, gestaltete für zwei Greizer Geschäftsleute dieses Gebäude, wovon einer Restaurateur
war. Bis 1949 gab es hier das Gasthaus "Zum Tunnel"'. Durch den Tunnel konnte man von der Thomasstraße direkt in die Marktstraße laufen.
Die figürliche Gestaltung des "Tunnelwappens" zeigt den Einfluss der Heimatkunst dieser Zeit. Vermutlich wurde dieser Herr ca. 1906 als
Reklamebild für das damalige Zeitschriftengeschäft angebracht. Greizer Historiker haben Ähnlichkeit mit dem Konterfei der von
1848 bis 1944 herausgegebenen Berliner Satirezeitung "Kladderadatsch" festgestellt und interpretieren sie als Ausdruck der politischen Gesinnung
des bürgerlichen Bauherrn. Das dem Land Österreich treu ergebene Fürstentum Reuß war immer wieder Zielscheibe der Preußen.
Das Maskottchen dieser Zeitschrift sieht dem "Greizer Tunnelwappen" zum Verwechseln ähnlich, zeigt doch die Greizer Figur lediglich
seitenverkehrt zum Original auf die Eingangstür des Geschäftes.
Marktstr. 16/Thomasstr. 19


 Das auffällige, geometrisch geformte Wohn- und Geschäftshaus strahlt Würde und Luxus aus und
verkörpert eines der ausdrucksstärksten Jugendstilgebäude in der Marktstraße. Deutlich zeigt der Jugendstil seine sich
ständig ändernde Liebe der Oberflächenreize. Wie sorgfältig das Verhältnis von glatter Putzfläche zu
vorgeblendetem Bossenmauerwerk gewählt wurde, zeigen u. a. die pointiert angebrachten Dekorationselemente. Einzelne Vergoldungen bilden
flimmernde Lichtpunkte. Die Fassade lebt durch Symmetrie in der Einzelform und Asymmetrien im Gesamteindruck.
Das auffällige, geometrisch geformte Wohn- und Geschäftshaus strahlt Würde und Luxus aus und
verkörpert eines der ausdrucksstärksten Jugendstilgebäude in der Marktstraße. Deutlich zeigt der Jugendstil seine sich
ständig ändernde Liebe der Oberflächenreize. Wie sorgfältig das Verhältnis von glatter Putzfläche zu
vorgeblendetem Bossenmauerwerk gewählt wurde, zeigen u. a. die pointiert angebrachten Dekorationselemente. Einzelne Vergoldungen bilden
flimmernde Lichtpunkte. Die Fassade lebt durch Symmetrie in der Einzelform und Asymmetrien im Gesamteindruck.
In der Thomasstraße wird der Zwerchgiebel offenbar von starken männlichen Masken getragen, die überproportional groß und
dominant wirken, als müssten sie die sanfte Schönheit zu ihrer Linken beschützen. Ihre mystischen Gesichter sind von Kettengliedern
umrahmt. Als Kopfschmuck tragen sie einen Drachen oder eine Fledermaus auf dem Haupt. Was den Symbolgehalt angeht, können nur Vermutungen
angestellt werden. Die Kette fungiert als ein altes Symbol der Verbindung zwischen Himmel und Erde, zwischen zwei Extremen oder zwei Lebewesen.
Als Zeichen des Glücks und des Schutzes steht die Fledermaus. Die Komposition bleibt rätselhaft und behält ihr Geheimnis für
sich, übt aber gerade deshalb eine starke Anziehungskraft aus.
Thomasstr. 25



 Auch hier haben wir wieder ein Beispiel dafür, dass verschiedene Baustile gleichberechtigt nebeneinander an einem Baukörper harmonieren.
In der Fassadengliederung bis hin zum Dekordetail sind neoklassizistische Vorbilder deutlich spürbar. Gleichzeitig treten charakteristische
Jugendstilelemente sichtbar in den Vordergrund. So sehen wir z. B. als stiltypische Eckbetonung direkt über dem abgeschrägten
Ladeneingang an der Thomasstraße eine feenhafte Schönheit mit langen welligen Haarsträhnen, die in einen Apfelzweig übergehen.
Der Apfel steht für Leben und ist Ausdruck weiblicher Kraft und Fruchtbarkeit. Ihr Kopfschmuck, einem krönenden Kapitell gleich, bildet
den Abschluss zum Mauerwerk.
Auch hier haben wir wieder ein Beispiel dafür, dass verschiedene Baustile gleichberechtigt nebeneinander an einem Baukörper harmonieren.
In der Fassadengliederung bis hin zum Dekordetail sind neoklassizistische Vorbilder deutlich spürbar. Gleichzeitig treten charakteristische
Jugendstilelemente sichtbar in den Vordergrund. So sehen wir z. B. als stiltypische Eckbetonung direkt über dem abgeschrägten
Ladeneingang an der Thomasstraße eine feenhafte Schönheit mit langen welligen Haarsträhnen, die in einen Apfelzweig übergehen.
Der Apfel steht für Leben und ist Ausdruck weiblicher Kraft und Fruchtbarkeit. Ihr Kopfschmuck, einem krönenden Kapitell gleich, bildet
den Abschluss zum Mauerwerk.
Im Jahre 2013 aufwendig saniert, ist der Sockel des Klinkerbau-Gebäudes mit Sandstein verblendet. Man beachte unbedingt das über der Fee
auffällig farbenfrohe Fenster.
An dem Giebel zur Marktstraßenseite befindet sich ein besonders schönes Marmorrelief. Dafür lohnt es sich, die Marstallstraße
zu queren und es von der Anhöhe zu betrachten. Wir sehen die antike Götterfigur Hermes, ein Symbol aus der Gründerzeit. Bis auf den
geflügelten Helm präsentiert er sich uns nackt. Bekannt als Schutzpatron der Handelsleute, ist er häufig an gründerzeitlichen
Villen und Geschäftshäusern zu sehen. Seine rechte Hand hält einen Anker, ein Zeichen dafür, dass der Hauseigentümer ferne
Handelsbeziehungen bezog. Die Uhr erinnert an den Handel und Bau von Uhren, welches in diesem Haus praktiziert wurde.
Burgstraße 8
Ein beliebtes Fotomotiv ist das Fassadenmosaik des Leipziger Kunst- und Glasmalers Wilhelm Mewes in der Burgstraße.
Der auffällige Wandschmuck lässt den Bezug zum Bauherrn eindeutig erkennen, zeigt es doch einen Gürtler in historischer Arbeitskleidung.
Juwelier und Goldschmiedemeister Paul Schaller ließ das Gebäude 1909 als Wohn- und Geschäftshaus errichten, nachdem 1908 ein
großflächiger Brand sein Haus wie auch weitere Gebäude am Markt bis auf die Grundmauern zerstörte.
Eckhäusern kam ein besonderer Stellenwert zu, der gestalterisch gern betont wurde.
Markt 16/Thomasstr. 5
In der Nacht zum 13. November 1908 brach im Hinterhof des Eckhauses Marktstr. 20 das Feuer aus und griff innerhalb kürzester Zeit auf die Nebengebäude über. Unter sparsamer Verwendung von Sand- und Kunststein bauten die Gebrüder Randel das Gebäude im Jahr 1909/1910 wieder auf. Eine weitere Ausdrucksmöglichkeit, um Häuser zu schmücken, war die Verzierung mit Gittern oder Balkongeländern. Schmiedeeisen eignete sich dafür perfekt. Der Mittelrisalit der Fassade schließt hier mit einem formschönen Schutzgitter ab. Unterhalb des Handlaufs finden sich die Perlen in Form einer Kette erneut wieder. Dem kreisrunden Ornament in der Mitte sollte man seine Aufmerksamkeit widmen. Wir wissen, dass es in Greiz zahlreiche Logen der Freimaurer gab. Gut gestellte Bürger von Greiz mit entsprechender Stellung waren Mitglieder dieser Bündnisse. Was erkennen Sie, als interessierter Beobachter, in der Mitte des Balkongitters?
Markt 14
Fleischermeister Paul Burkhardt beauftragte 1909 nicht wie die meisten Brandgeschädigten einen einheimischen, sondern einen auswärtigen Architekten mit dem Bau eines neuen Gebäudes. Der Chemnitzer Architekt Anton H. Kunz schuf einen Neubau, der sich in der Häuserzeile durch seine einzigartige Fassadengestaltung hervorhebt und als Visitenkarte des Bauherrn fungiert. Die vollständige Natursteinfassade ist in Greiz eine Seltenheit. Architektonisch zählt das Bauwerk zum lotrechten Jugendstil, d. h. die Fassade ist streng symmetrisch und konsequent in vertikale Bahnen gegliedert. Das Dekor wird von einem streng geordnetem Ornamentensystem bestimmt.
Marienstraße 10-12
Mit dem Neubau des sich anschließenden Schulgebäudes wurde auch die ehemalige Kindergrippe neu errichtet. Beide Gebäude gehen zurück auf die Pläne des Plauener Architekten Max Mayer und wurden im Jahr 1910 eingeweiht. Material, Farbgebung und einzelne Details korrespondieren zueinander und erscheinen als ein harmonisches Gesamtwerk. Wie auch der dreiflügelige Schulkomplex ist die Fassade der Marienstraße 10 in Kammputz ausgeführt und vom sachlichen Jugendstil geprägt. Der hohe Sockel des Tiefparterres in Bruchsteinmauerwerk und das steile Mansarddach verleihen den Bauten einen stiltypischen Habitus. Die Kunst des Jugendstils lässt sich an den noch originalen Halterungen für Blumenkästen finden. Das Kind über der Eingangstür zur ehemaligen Krippe weist auf deren ursprüngliche Gesinnung hin. Das Schulgebäude dagegen besticht durch Eckerker, Festons und grün-weiße Fensterläden, welche die ehemalige Direktoriats-Ebene im 1. OG betonen.
Puschkinplatz 12, 12a, 14




 Das erste Warenhaus in Greiz gehörte Julius Tietz, einem jüdischen Geschäftsmann aus Nürnberg. Er gründete es unter dem
Namen seines Bruders Heinrich Tietz. Julius und Heinrich Tietz waren Brüder von Hermann Tietz, der als Geld- und Namensgeber der
Hertie-Warenhäuser bekannt ist. Der in Stein und Eisenbeton ausgeführte Kaufhausbau war wohl der erste in dieser Technik in Greiz,
wodurch großflächige Schaufensterverglasungen und der Bau von Lichthöfen umgesetzt werden konnten.
Das erste Warenhaus in Greiz gehörte Julius Tietz, einem jüdischen Geschäftsmann aus Nürnberg. Er gründete es unter dem
Namen seines Bruders Heinrich Tietz. Julius und Heinrich Tietz waren Brüder von Hermann Tietz, der als Geld- und Namensgeber der
Hertie-Warenhäuser bekannt ist. Der in Stein und Eisenbeton ausgeführte Kaufhausbau war wohl der erste in dieser Technik in Greiz,
wodurch großflächige Schaufensterverglasungen und der Bau von Lichthöfen umgesetzt werden konnten.
Durch den Neorenaissancegiebel und die Glasfassade an der Nordseite bekam das Gebäude ein großstädtisches Aussehen. Da, wo der
Jugendstil sonst auf Ornamente setzt, ist die durch Pilaster gegliederte Kaufhausfassade eher schlicht-geometrisch. Die Geschichte des Hauses
erzählen Jugendstilelemente der Fassade:
In der stehenden Gaube über dem flachen Runderker hat sich z. B. der Kaufmann Eduard Lippmann mit seinen Initialen verewigt. Er übernahm
bereits 1887 die Posamentenhandlung der Firma Tietz am Greizer Markt und nach dem Tod von Heinrich Tietz 1910 das neue Kaufhaus am
Ernst-Arnold-Platz. Am Eckturm befindet sich eine Kartusche mit einem goldenen T wie Tietz, dessen Familie den Grundstein für das Kaufhaus bzw.
die Warenhauskette legte. Auch in der Spitze des Neorenaissancegiebels prangt ein großes T. Ein weiteres Ornament stellt den Schutzgott Hermes
über einem Segelschiff dar. Er beschützt die Kaufleute, die "mit geblähten Segeln auf dem Weg zum Erfolg" sind. Daneben stehen
zwei Adler für Weitblick, Mut und Kraft sowie ein Anker für Hoffnung und Stabilität.
Brückenstraße 3-5


 Das als Wohn- und Geschäftshaus im Jahr 1911 errichtete Gebäude erscheint in typischer Kaufhausmanier. Voller Stolz und Grazie empfängt
es die Besucher der Brückenstraße. Seit 2015, nach einer umfangreichen Sanierung, ist die Greizer Innenstadt um dieses architektonische
Highlight reicher.
Das als Wohn- und Geschäftshaus im Jahr 1911 errichtete Gebäude erscheint in typischer Kaufhausmanier. Voller Stolz und Grazie empfängt
es die Besucher der Brückenstraße. Seit 2015, nach einer umfangreichen Sanierung, ist die Greizer Innenstadt um dieses architektonische
Highlight reicher.
Wurde die Nutzung des Gebäudes teilweise gravierend geändert, blieben Ornamente, Putzspiegel und Simse vollständig und
originalgetreu erhalten. Die Laden-Schaufenster im Erdgeschoss blieben unverändert. In Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde
wurden Farbanstrich und die Gestaltung der Fassade denkmalgerecht aufgearbeitet.
Steht man hinter der Brüstung zum Sparkassengebäude, kann man das strahlende Haus besonders gut in Augenschein nehmen. In
symmetrischer Abfolge lassen sich von Eingangstür über Rundbogenfenster zu floralen Putzreliefs dekorative Elemente betrachten.
Auffällig ist der geschwungene Giebel, der mit seinem geschmückten Oculus (Rundfenster) den Abschluss der dominanten Schauseite bildet.
Die spiegelgleichen Runderker begrenzen die Fassade zur Linken und zur Rechten.
Brückenstraße 10 und 12



 Es gibt kaum einen Straßenzug in Greiz, der so viele Veränderungen im Laufe der Zeit erlebt hat. Feuersbrünste, Abrisse,
Sanierungsmaßnahmen und Verkehrsänderungen gaben der Greizer Brückenstraße stets ein neues Gesicht. So ist es nicht
verwunderlich, dass auch hier unterschiedlichste Facetten der Architektur zu finden sind. Die gut proportionale und solide Formensprache
des Jugendstil lässt sich vor allem am Haus der Brückenstraße 10 und 12 ablesen. Zwei Giebel unterschiedlicher Größe
bekrönen den Abschluss des Gebäudes. Der in der Mitte liegende, elegant ausgeformte Runderker tritt etwas zurückhaltend aus der
Fassade hervor. Bewusst wird hier auf figurative Elemente in der Fassadengestaltung verzichtet. Der Schwerpunkt liegt auf den hervorstechenden
Putzreliefs, deren Wirkung sich unverwechselbar von allen anderen Gebäuden der kleinen Einkaufspassage abhebt.
Es gibt kaum einen Straßenzug in Greiz, der so viele Veränderungen im Laufe der Zeit erlebt hat. Feuersbrünste, Abrisse,
Sanierungsmaßnahmen und Verkehrsänderungen gaben der Greizer Brückenstraße stets ein neues Gesicht. So ist es nicht
verwunderlich, dass auch hier unterschiedlichste Facetten der Architektur zu finden sind. Die gut proportionale und solide Formensprache
des Jugendstil lässt sich vor allem am Haus der Brückenstraße 10 und 12 ablesen. Zwei Giebel unterschiedlicher Größe
bekrönen den Abschluss des Gebäudes. Der in der Mitte liegende, elegant ausgeformte Runderker tritt etwas zurückhaltend aus der
Fassade hervor. Bewusst wird hier auf figurative Elemente in der Fassadengestaltung verzichtet. Der Schwerpunkt liegt auf den hervorstechenden
Putzreliefs, deren Wirkung sich unverwechselbar von allen anderen Gebäuden der kleinen Einkaufspassage abhebt.
Etwas markanter ist das Nebengebäude, dessen Erker sich zur Straßenecke richtet. Hier findet sich ein wunderbares Beispiel des
Späthistorismus, ein Vermischen von neogotischen Architekturrahmungen mit Jugendstilfüllungen.
Parkgasse 46-48



 Dieses Gebäude zählt zu den schönsten Schöpfungen des Jugendstils und bei einem Spaziergang durch den Fürstlich Greizer Park
sollte man ihm durchaus große Aufmerksamkeit schenken. Es ist ein klassisches Zeugnis vom Repräsentationswillen eines wirtschaftlich
erstarkenden Bürgertums in der ehemaligen Textilhochburg Greiz.
Dieses Gebäude zählt zu den schönsten Schöpfungen des Jugendstils und bei einem Spaziergang durch den Fürstlich Greizer Park
sollte man ihm durchaus große Aufmerksamkeit schenken. Es ist ein klassisches Zeugnis vom Repräsentationswillen eines wirtschaftlich
erstarkenden Bürgertums in der ehemaligen Textilhochburg Greiz.
Eine Vermischung von Gründerzeit und Jugendstil ist auch hier gegeben. Die Fassade im Sockelbereich sowie im Hochparterre ist mit rotem
Backstein verkleidet. Die asymmetrische Fassadeneinteilung mit acht Fensterzügen ist in den oberen Etagen mit Putz versehen. Schmale Fenster
im Erker, dreigeteilt und mit Oberlicht ausgestattet, sind gründerzeitlich und beeindrucken durch geschweifte Rahmen. Der obere Teil der
Fassade, allem voran zwei Erker, werden deutlich vom Jugendstil dominiert.
Leonhardtstraße 21
Das im Jahr 1903 vom Baumeister C. August Daßler erbaute Gesellschaftshaus diente als neuer Sitz der Loge Vogtland Nr. 7 von Sachsen (Odd-Fellow-Loge). Das Gebäude fügt sich in den Charakter einer Villenstraße ein, trotzdem zeigt die Fassade deutlich die Formensprache des neuen Stils und hebt sich von den anderen Stadtvillen ab. Asymmetrische Gestaltung, unterschiedlichste Fensterformen, Eckpilaster und ein mit floralen Ornamenten geschmückter Erker geben der Straßenfront eine eigenwillige Gestalt. Der Eingang wird durch den darüber positionierten Erker geschützt und von zwei Fledermausfiguren an den Konsolen bewacht. Mit der Fledermaus verbindet sich etwas Rätselhaftes und Unheimliches. Das Tier wird als Abwehr gegen böse Mächte und als glücksbringend geschätzt. Besonders wenn man es mit ausgebreiteten Flügeln wie hier darstellt, steht es als Schutzsymbol gegen Hexen, Feuer und Blitz. Die elegante Haustür bildet mit charakteristisch geschwungenen Fensterflächen, Kämpfern und Oberlichtsprossen einen besonderen Blickfang. Nicht nur bei der Gestaltung der Fenster, auch beim zurückgesetzten Eingang wird die Abrundung der Gebäudeecken bevorzugt, so dass man regelrecht ins Haus geleitet wird und sich willkommen fühlt. Das individuelle Gebäude ist ein bemerkenswerter Vertreter des Jugendstils in Greiz.
Gartenweg 2


 Ein sehenswertes Beispiel der Jugendstilarchitektur in der überwiegend gründerzeitlich geprägten Greizer Neustadt ist die
dreigeschossige denkmalgeschützte Mietvilla Gartenweg 2, die sich mit einer 2016 sanierten Jugendstilfassade präsentiert.
Ein sehenswertes Beispiel der Jugendstilarchitektur in der überwiegend gründerzeitlich geprägten Greizer Neustadt ist die
dreigeschossige denkmalgeschützte Mietvilla Gartenweg 2, die sich mit einer 2016 sanierten Jugendstilfassade präsentiert.
Der Architekt und Bauherr H. P. Hoffmann entwarf das Haus 1906 und vermietete die Wohnungen an gut situierte Bürgerliche wie Lehrer,
Kaufleute und Fabrikbesitzer. Er selbst wohnte ein paar Häuser weiter. Geschickt kombinierte Hoffmann bei diesem Gebäude
unterschiedliche Materialien: Der Sockel ist natursteinbelassen. Unterhalb der 1. Etage befinden sich blau-weiße Keramikfliesen zur
Akzentuierung der Südfenster, die Haube an Süd- und Eckerker ist kupfern und zur Gestaltung des Dachgeschosses und des West-Erkers
greift er auf Fachwerk als Element zur Fassadengestaltung zurück. Die Straßenfront des 3. Geschosses hat er dabei besonders mit
Stuck betont.
Kirche Reinsdorf



 Wer auf den Spuren des Jugendstils durch Greiz wandelt, sollte sich die Gotteshäuser im Jugendstil nicht entgehen lassen. Die
Evangelisch-Lutherische "Kirche zur Heiligen Dreifaltigkeit" im Ortsteil Reinsdorf ist heute eine der wenigen Kirchen mit Jugendstilausmalung.
Sie wurde unter Benutzung von Bauteilen aus dem 14. Jahrhundert 1720 im Barock errichtet. Nach einem Brand im Januar 1911 gingen Gestühl,
Emporen und Orgel verloren. Im selben Jahr wurde die Inneneinrichtung erneuert und das Langhaus erhielt zwei seitenschiffähnliche Anbauten.
Beim Wiederherrichten ließ der Leipziger Architekt Paul Lange (1853-1932) den neuen Kunststil einfließen. Paul Lange wird als
Kirchenbaumeister bezeichnet, da er zahlreiche Kirchen errichtet, umgebaut oder restauriert hat, darunter etliche Dorfkirchen. Großen Wert
legte er auf die Innenarchitektur. Mit ihrem restaurierten Innenraum bildet die kleine, denkmalgeschützte Kirche ein Kleinod von
überregionaler Bedeutung.
Wer auf den Spuren des Jugendstils durch Greiz wandelt, sollte sich die Gotteshäuser im Jugendstil nicht entgehen lassen. Die
Evangelisch-Lutherische "Kirche zur Heiligen Dreifaltigkeit" im Ortsteil Reinsdorf ist heute eine der wenigen Kirchen mit Jugendstilausmalung.
Sie wurde unter Benutzung von Bauteilen aus dem 14. Jahrhundert 1720 im Barock errichtet. Nach einem Brand im Januar 1911 gingen Gestühl,
Emporen und Orgel verloren. Im selben Jahr wurde die Inneneinrichtung erneuert und das Langhaus erhielt zwei seitenschiffähnliche Anbauten.
Beim Wiederherrichten ließ der Leipziger Architekt Paul Lange (1853-1932) den neuen Kunststil einfließen. Paul Lange wird als
Kirchenbaumeister bezeichnet, da er zahlreiche Kirchen errichtet, umgebaut oder restauriert hat, darunter etliche Dorfkirchen. Großen Wert
legte er auf die Innenarchitektur. Mit ihrem restaurierten Innenraum bildet die kleine, denkmalgeschützte Kirche ein Kleinod von
überregionaler Bedeutung.
Gottesackerkirche, Friedhofstraße 25



 Fotos © Lutz Zürnstein
Fotos © Lutz Zürnstein
Wie der Name schon sagt, steht die Gottesackerkirche auf dem einstigen alten Friedhof der Stadt Greiz. Stadtbaumeister Hugo Hüfner (1877-1954)
erbaute gemeinsam mit seinem Bauassistenten Alfred Thomas (1871-1953) auf den alten Grundmauern den Neubau im Jahr 1912 im Jugendstil.
Außenhülle und Inneneinrichtung der Kirche sind bis heute nahezu unverändert erhalten geblieben. Große, dreigeteilte Fenster
im Querschiff setzen innen wie außen einen gestalterischen Akzent. Im Gegensatz zu den sonstigen Fenstern werden diese an der Außenfassade
durch Baudekor in Jugendstilmanier an den Fenstergewänden straßen- und hofseitig hervorgehoben. An der Ostapsis betonen die geschwungene
Trauflinie und das ovale Fenster die Ansicht. Ebenfalls an der Straßen- bzw. Hoffront fallen erst bei genauem Hinsehen die zwei kleinen Reliefs
ins Auge. Auf den Ziertafeln sind Tier- und Pflanzenmotive als typische Elemente des Jugendstils zu sehen.
Grabstätte der Familie Gustav Mollberg



 Auf dem Neuen Friedhof biegt man vom oberen Hauptweg nach etwa 200 Metern links ab und gelangt zur Abteilung I, wo sich die Grabstätte
befindet. Dort wurden 1902 Rudolf Mollberg, 1932 Emma, Auguste Mollberg (geb. Knupe) und 1938 Gustav Mollberg beigesetzt. Der ehemalige
Stadtbaurat Mollberg wurde als technischer Fachmann weithin geschätzt. Die Grabstelle ist ein Ort, wo Geist und Gestaltungswille der Zeit
um 1900 anschaulich zu erleben sind. Der Schriftzug am Grabstein, die Gestalt der steinernen Elemente und die schmiedeeiserne Einfassung um das
Grabmal zeigen sich in zeitgemäßer Formensprache. Besonders auffällig sind die schwarzen, symmetrisch gestalteten Metallfelder
der Grabeinfriedung in deutlicher Jugendstilmanier. Der Entwurfsverfasser verwendete als Motiv Mohnkapseln, ein Zeichen des Traumes und behüteten
Schlafes. Leider ist er bisher unbekannt.
Auf dem Neuen Friedhof biegt man vom oberen Hauptweg nach etwa 200 Metern links ab und gelangt zur Abteilung I, wo sich die Grabstätte
befindet. Dort wurden 1902 Rudolf Mollberg, 1932 Emma, Auguste Mollberg (geb. Knupe) und 1938 Gustav Mollberg beigesetzt. Der ehemalige
Stadtbaurat Mollberg wurde als technischer Fachmann weithin geschätzt. Die Grabstelle ist ein Ort, wo Geist und Gestaltungswille der Zeit
um 1900 anschaulich zu erleben sind. Der Schriftzug am Grabstein, die Gestalt der steinernen Elemente und die schmiedeeiserne Einfassung um das
Grabmal zeigen sich in zeitgemäßer Formensprache. Besonders auffällig sind die schwarzen, symmetrisch gestalteten Metallfelder
der Grabeinfriedung in deutlicher Jugendstilmanier. Der Entwurfsverfasser verwendete als Motiv Mohnkapseln, ein Zeichen des Traumes und behüteten
Schlafes. Leider ist er bisher unbekannt.
Cloßstraße 9-15
Über die Himmelsleiter gelangt man den Pohlitzberg aufwärts zur Cloßstraße. Dort hat der Architekt C. August Daßler zwischen 1900 und 1911 mehrere qualitätsvolle Mietsvillen in exponierter Lage errichtet. Diese Gebäude verkörpern einen neuen Haustyp, den der repräsentative bürgerliche Wohnungsbau hervorbrachte. Sie präsentieren sich als zeitgemäße, mehrgeschossige Mietshäuser im Landhausstil, die neben historisierenden Elementen typische Merkmale des Jugendstils im Fassadenschmuck aufweisen. Als Besonderheit ist bei Haus Nr. 12 der Anbau für eine ehemalige industrielle Produktionsstätte nachweisbar, der von der Vielfalt des Greizer Jugendstils zeugt. Hierbei handelt es sich nicht um einen einfachen Zweckbau, sondern um Industriearchitektur im schlichten Jugendstil, die Funktionalität und repräsentative Wirkung vereint. Max Hetzheim, damaliger Eigentümer der Cloßstraße 12, ließ die Stickerei 1907 errichten. Seine Initialen sind deutlich an der südlichen Giebelseite des Anbaus zu erkennen.
Waldstraße 2-15
Im Zuge der fortschreitenden Industrialisierung und des rapiden Bevölkerungswachstums wurde dringend Wohnraum benötigt. Zwischen 1902 und 1913 errichteten der Maurermeister Albin Freund und der Bauunternehmer Friedrich Schellenberg 15 Gebäude in der Waldstraße. Dabei handelt es sich um zwei- bis dreigeschossige qualitätsvolle Mietshäuser einer Straßenzeile in exponierter Lage. Die dem Jugendstil verpflichteten Wohnbauten zeigen, dass teurer Fassadenschmuck nicht mehr ausschließlich den Villen der Reichen vorbehalten war, sondern auch für Mietshäuser selbstverständlich wurde. So entstanden einzigartige Hausgesichter, obwohl es sich in den meisten Fällen um reine "Bauträgermodelle" handelte, also um Häuser, die für spätere Eigentümer und anonyme Mieter errichtet wurden. Man verzichtete auf verschwenderischen Linienreichtum und Verspieltheit. Die Fassaden, Dächer und Erker der Mietshäuser sind dennoch phantasie- und formenreich. Besonders hervorzuheben ist die abwechslungsreiche Gestaltung der Türgewände.
Tannendorfbrücke

 Mit einem Gesamtprojekt, das den Bau der Tannendorfbrücke, den Bau der Verbindungsbrücke über die Weiße Elster zwischen der
neuen Elsterberger Straße und dem Göltzschtal sowie den Bau der neuen Friedrich-Arnold-Straße (heute Plauensche Straße)
umfasste, wurde zwischen 1911 und 1914 eine neue Verbindung zum Tannendorfplatz und damit nach Obergrochlitz bzw. Elsterberg hergestellt. Durch
diesen gewaltigen Bau wurden fünf Bahnübergänge, die für den öffentlichen Verkehr doch recht hinderlich waren, beseitigt
und der gesamte Verkehr, der sich auf den fünf Übergängen abspielte, über die gewaltige Brücke konzentriert geleitet.
Dieses stolze Bauwerk ist eine komplizierte Stahlträgerkonstruktion mit 48 m Spannweite, die schiefwinklig über die Bahnlinie führt.
Der Brückenträger wird von zwei aus Naturstein gemauerten Widerlagern gehalten. Pylone bilden das Tor zur Brücke. Auf diesen sind
inzwischen originalgetreu nachgebaute Jugendstil-Lampen montiert, wodurch die vertikale Wirkung verstärkt wird. Eine aus Ziegeln gemauerte
Balustrade verbindet diese mit den Pfeilern an den Brückenköpfen. Sämtliche konstruktiven Knotenpunkte und Verbindungen der
Stahlträgerkonstruktion sind genietet. Die zahlreichen Nieten entfalten dabei einen dekorativen Effekt.
Mit einem Gesamtprojekt, das den Bau der Tannendorfbrücke, den Bau der Verbindungsbrücke über die Weiße Elster zwischen der
neuen Elsterberger Straße und dem Göltzschtal sowie den Bau der neuen Friedrich-Arnold-Straße (heute Plauensche Straße)
umfasste, wurde zwischen 1911 und 1914 eine neue Verbindung zum Tannendorfplatz und damit nach Obergrochlitz bzw. Elsterberg hergestellt. Durch
diesen gewaltigen Bau wurden fünf Bahnübergänge, die für den öffentlichen Verkehr doch recht hinderlich waren, beseitigt
und der gesamte Verkehr, der sich auf den fünf Übergängen abspielte, über die gewaltige Brücke konzentriert geleitet.
Dieses stolze Bauwerk ist eine komplizierte Stahlträgerkonstruktion mit 48 m Spannweite, die schiefwinklig über die Bahnlinie führt.
Der Brückenträger wird von zwei aus Naturstein gemauerten Widerlagern gehalten. Pylone bilden das Tor zur Brücke. Auf diesen sind
inzwischen originalgetreu nachgebaute Jugendstil-Lampen montiert, wodurch die vertikale Wirkung verstärkt wird. Eine aus Ziegeln gemauerte
Balustrade verbindet diese mit den Pfeilern an den Brückenköpfen. Sämtliche konstruktiven Knotenpunkte und Verbindungen der
Stahlträgerkonstruktion sind genietet. Die zahlreichen Nieten entfalten dabei einen dekorativen Effekt.